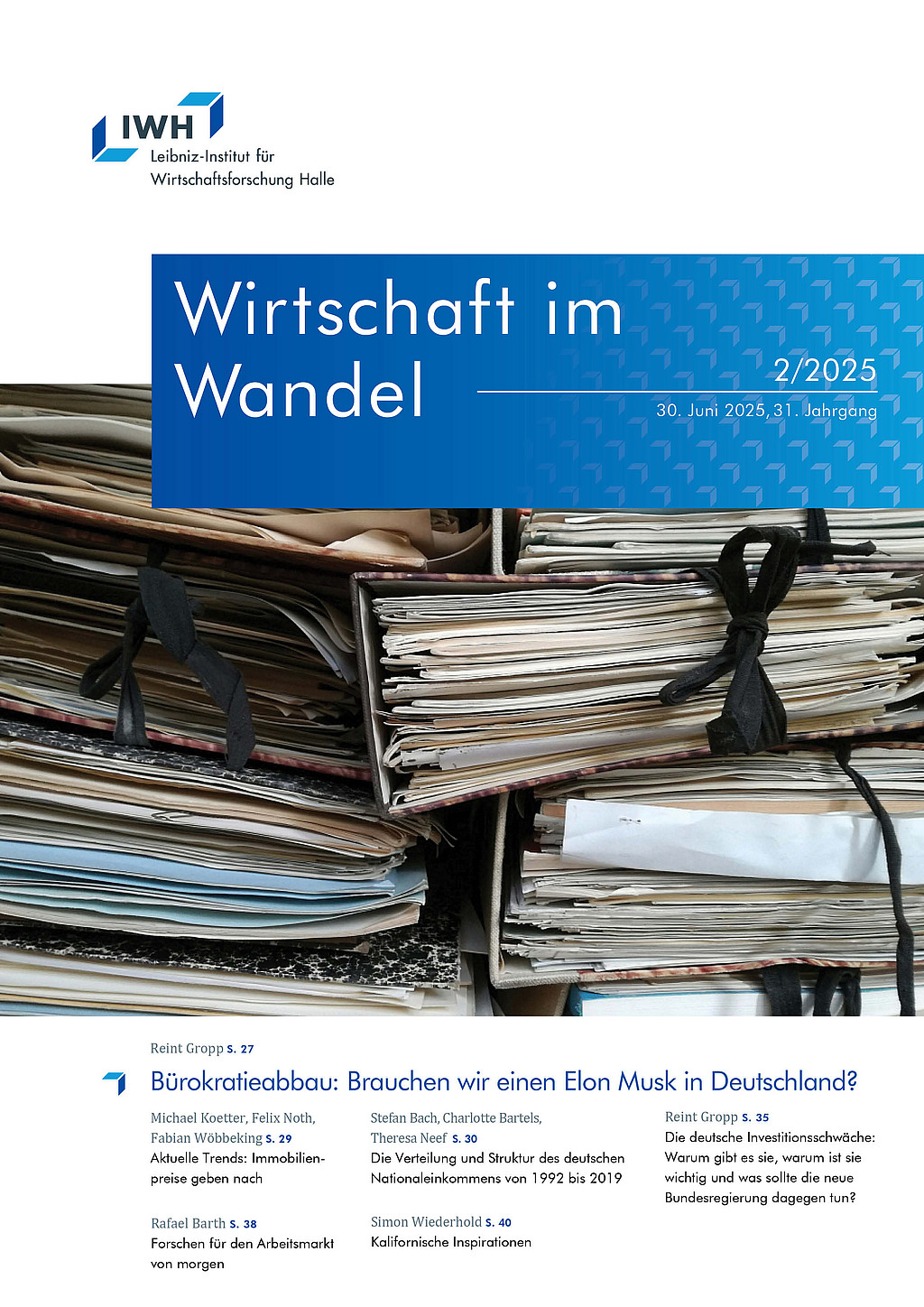
Kalifornische Inspirationen
Wissenschaft lebt vom Austausch kluger Köpfe über Grenzen hinweg. IWH-Ökonom Simon Wiederhold hat vier Wochen an der Stanford University geforscht. Einblicke in eine höchst anregende Erfahrung.
01. July 2025
https://doi.org/10.18717/wwn30p-va95

Sattes Frühlingsgrün, Palmen, sonnenbeschienene Innenhöfe: Wer einmal über den Campus der Stanford University südlich von San Francisco spaziert ist, versteht schnell, warum dieser Ort so viele kluge Köpfe anzieht. Im April durfte ich vier Wochen als Gastforscher an der renommierten Hoover Institution verbringen. Eingeladen hatte mich Eric A. Hanushek, weltweit einer der profiliertesten Ökonomen an der Schnittstelle von Bildung und Arbeitsmarkt und mein langjähriger Ko-Autor.
Die Zeit war intensiv und anregend, nicht nur wegen der kalifornischen Sonne, sondern vor allem wegen des intellektuellen Klimas. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort war unkompliziert, neugierig und inspirierend. Es ist beeindruckend, mit welcher Offenheit Forschende in Stanford auch über erste Ideen, gescheiterte Hypothesen oder neue methodische Zugänge diskutieren. Und dabei wirken sie so „laid-back“, wie man es der amerikanischen Westküste gern nachsagt – eine entspannte Haltung, die ansteckend ist und zum Nachdenken einlädt.

Während meines Aufenthalts habe ich an einem Projekt zu den globalen Arbeitsmarkterträgen von Kompetenzen gearbeitet. Schon in einer früheren Studie hatten wir unter anderem gemeinsam mit Hanushek gezeigt, dass sich bessere Bildung in den USA besonders stark auszahlt. In kaum einem anderen Land sind die Lohnerträge kognitiver Fähigkeiten so hoch. Stanford bot nun die ideale Umgebung, um die Frage weiterzuverfolgen, ob das auch heute noch gilt. Möglich macht das der neue, nunmehr zweite Erhebungszyklus der internationalen PIAAC-Studie der OECD. Damit lassen sich erstmals Entwicklungen von Kompetenzen und Kompetenzerträgen über den Verlauf eines Jahrzehnts analysieren.
Außerdem habe ich ein Forschungsprojekt vorgestellt, das sich mit der Rolle administrativer Hürden bei der Inanspruchnahme familienpolitischer Leistungen beschäftigt. In einer groß angelegten Feldstudie in zwei deutschen Städten zeigen meine Ko-Autoren, -Autorinnen und ich, dass viele Eltern trotz rechtlichem Anspruch keinen Kita-Platz haben – oftmals aber nicht, weil sie keinen Platz möchten, sondern weil Informationen fehlen oder bürokratische Prozesse abschrecken. Eine einfache Bereitstellung von Informationen zum Kita-System und ein wenig Hilfe im Bewerbungsprozess erhöhten nicht nur die Inanspruchnahme von Kinderbetreuung, sondern auch die Vollzeiterwerbstätigkeit von Müttern deutlich. Besonders spannend war es, diese Ergebnisse in Stanford zu diskutieren: Mütter gehen in den USA in der Regel deutlich früher als in Deutschland wieder arbeiten, und Kinderbetreuung ist ganz anders organisiert als bei uns.

Die Frage, wie bürokratische Hürden den Zugang zu familienpolitischen Leistungen erschweren – und wie man diese wirksam abbauen kann – habe ich ebenfalls weiterverfolgt. In den USA ist dies ein hochrelevantes Thema, und es war interessant zu sehen, wie ähnlich sich manche Herausforderungen trotz sehr unterschiedlicher institutioneller Kontexte sind. Besonders inspirierend waren Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, die innovative Feldexperimente zu digitalen Informations- und Antragsportalen durchführen. Die Idee, evidenzbasierte Politikberatung mit pragmatischen technischen Lösungen zu verbinden, möchte ich künftig auch in meine Arbeit in Deutschland stärker einfließen lassen.

Neben der Forschung kam in Stanford auch das Nachdenken über die politischen Rahmenbedingungen von Wissenschaft nicht zu kurz. Die aktuelle Wissenschaftspolitik in den USA – etwa die Debatten um die Zukunft des Bildungsministeriums oder Einschränkungen beim Zugang zu nationalen Datensätzen – war regelmäßig Thema auf dem Campus. Auch die Situation vieler US-Universitäten wurde diskutiert, insbesondere angesichts der Unsicherheit über den Fortbestand internationaler Mobilität und der Visa-Praxis, wie zuletzt am Beispiel Harvard sichtbar wurde. Trotz dieser Herausforderungen herrschte ein vorsichtiger Optimismus, dass sich die Rahmenbedingungen für freie und offene Wissenschaft wieder verbessern werden
Was bleibt nach vier Wochen Stanford? Neue Impulse, viele offene Fragen – und die Erfahrung, wie produktiv und wohltuend es sein kann, mit Abstand und in einem neuen Umfeld über die eigene Forschung nachzudenken. Vieles wird sich wohl erst mit etwas zeitlichem Abstand entwickeln. Fest steht aber schon jetzt: Diese Reise hat sich gelohnt.





