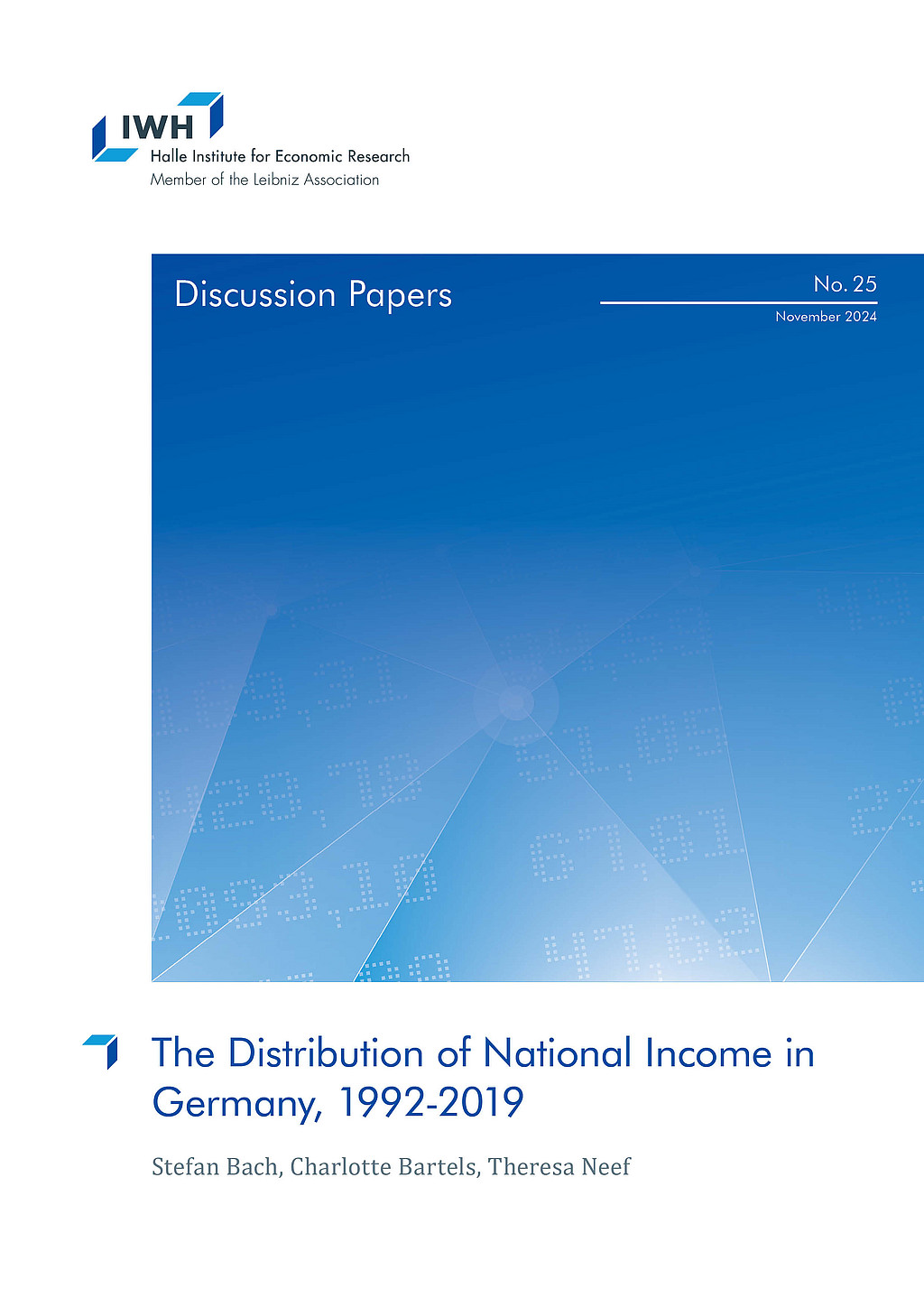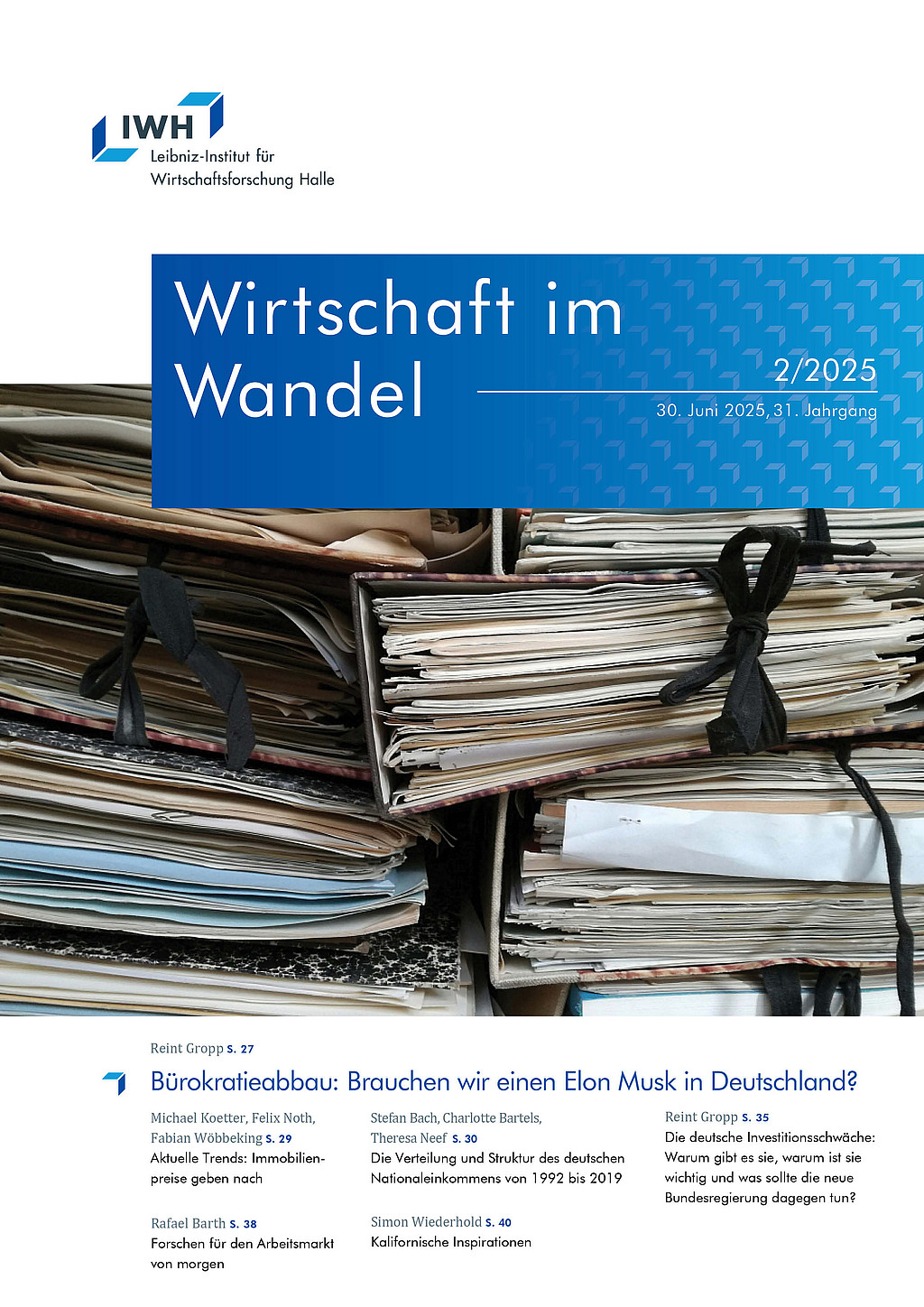
Die Verteilung und Struktur des deutschen Nationaleinkommens von 1992 bis 2019
Wie haben sich die Einkommen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in Deutschland seit der Wiedervereinigung entwickelt? Unsere Studie untersucht die Entwicklung und Zusammensetzung des Nationaleinkommens entlang der Verteilung im Zeitraum von 1992 bis 2019. Während die untere Hälfte der Einkommensverteilung (unterhalb des Medianeinkommens) bis Mitte der 2000er Jahre reale Einkommensverluste verzeichnete, stiegen die Einkommen der oberen Mittelschicht (die obersten 10%, ohne das einkommensstärkste 1%) stetig. Die Spitzeneinkommen (oberstes 1%) blieben zwischen 1992 und 2019 relativ stabil. Arbeitseinkommen dominieren bei den unteren 99%, während das oberste 1% von Unternehmenseinkommen – insbesondere aus arbeitsintensiven Dienstleistungsunternehmen und freien Berufen – bestimmt ist. Unsere Ergebnisse sind zentral für die Debatte über Reformen der Sozialversicherungsbeiträge und der Einkommensbesteuerung.
01. July 2025
https://doi.org/10.18717/wwj0jr-9209
Contents
Page 1
Datengrundlage und MethodikPage 2
Die Verteilung des NationaleinkommensPage 3
AusblickPage 4
Endnoten All on one pageWie sich die Einkommen verschiedener Bevölkerungsgruppen entwickeln, ist eine zentrale Frage für Politik und Gesellschaft – etwa im Hinblick auf Reformen der Sozialversicherungsbeiträge, der Einkommensbesteuerung, der Ausgestaltung von Sozialleistungen oder öffentlicher Investitionen. Um beurteilen zu können, wie sich solche Reformen auf unterschiedliche Gruppen auswirken, wer Beiträge zahlt und wer Leistungen bezieht, braucht es ein genaues Verständnis der Einkommensstruktur entlang der Verteilung.
Dieser Beitrag zeigt, basierend auf einer jüngst veröffentlichten Studie1, dass sich die Einkommen verschiedener Einkommensgruppen in Deutschland in den letzten drei Jahrzehnten ungleich entwickelt haben. Während die untere Hälfte der Einkommensverteilung bis Mitte der 2000er Jahre reale Einkommensverluste hinnehmen musste, stiegen vor allem die Einkommen der oberen Mittelschicht (90. bis 99. Perzentil)2, vor allem durch steigende Lohneinkommen von Besserverdienenden. Die Spitzeneinkommen (oberstes 1%) blieben dagegen weitgehend stabil. Ein großer Teil der Spitzeneinkommen stammt aus arbeitsintensiven Dienstleistungsunternehmen wie Rechts-, Steuer-, IT- und Unternehmensberatungen, Ingenieurbüros und medizinischen Praxen.
Datengrundlage und Methodik
Wir kombinieren Mikrodaten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik mit Befragungsdaten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) und Aggregaten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, um die Verteilung des Nettonationaleinkommens in Deutschland zu schätzen. Das Nettonationaleinkommen umfasst das von Inländern empfangene Arbeitnehmerentgelt, Unternehmens- und Vermögenseinkommen sowie das Staatseinkommen (u. a. Nettoproduktions- und Importabgaben).
Unsere Analyse folgt der Methodik des World Inequality Labs, das für viele Länder weltweit länderspezifische Zeitreihen zu so genannten Distributional National Accounts (DINA) bereitstellt.3 Unsere Datenbasis deckt individuelle Einkommen der gesamten erwachsenen Bevölkerung in Deutschland ab, rund 67 Millionen Personen im Jahr 2019.
Wir ordnen die Individuen vom einkommensschwächsten bis zum einkommensstärksten und fassen sie in vier Gruppen zusammen: die unteren 50%, die mittleren 40% (50. bis 90. Perzentil), das 90. bis 99. Perzentil und das oberste 1%. Dank der detaillierten Mikrodaten können wir die Verteilung bis zu den obersten 0,01% erfassen und die Einkommenszusammensetzung analysieren. Da die Daten nur Querschnittsinformationen enthalten, erlauben sie jedoch keine Aussagen zur Einkommensmobilität. Personen können in verschiedenen Jahren unterschiedlichen Einkommensgruppen angehören, etwa, wenn Studierende später zu besserverdienenden Arbeitnehmern werden. Wir untersuchen die Verteilung des Nationaleinkommens vor Steuern. Dies umfasst alle Markteinkommen aus Kapital und Arbeit, einschließlich der einbehaltenen Unternehmensgewinne. Für jede Person ziehen wir gezahlte Sozialversicherungsbeiträge ab und rechnen empfangene Sozialversicherungsleistungen, vor allem Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, hinzu. Dadurch entsteht eine individuelle Umverteilung über die Sozialversicherung, insbesondere im Verlauf des Lebens. Nicht berücksichtigt sind in dieser Analyse die Umverteilung durch Steuern und bedarfsgeprüfte Transfers wie das Bürgergeld.